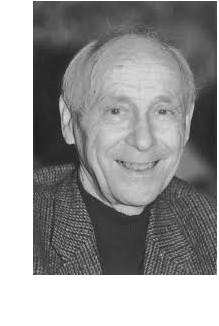
Alfred Hoffmann wirkte von 1964 bis 1976 als Professor für Sprache und Literatur Chinas an der Ruhr-Universität Bochum und trug als erster Inhaber des Lehrstuhls maßgeblich zum Aufbau des damals noch so bezeichneten Instituts für Ostasienwissenschaften und der Fachbibliothek bei.
Hoffmann wurde am 28. März 1911 in Eschweiler in der Nähe von Aachen geboren. Ab 1929 studierte er an der Friedrich-Wilhelm-Universität (d. i. die heutige Humboldt-Universität zu Berlin) und am Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin Philologie, mit Schwerpunkt auf der chinesischen Sprache. Bereits 1931 bestand er seine Prüfung als Diplom-Dolmetscher. Danach studierte und arbeitete er am Seminar für Sprache und Kultur Chinas der Universität Hamburg, wo er sich mit dem Sinologen Wolfgang Franke anfreundete, der ihm eine „absolute Sprachbegabung“ sowie großes Interesse an der zeitgenössischen chinesischen Literatur bescheinigte. Nach seiner mündlichen Not-Doktorprüfung im Fach Sinologie wurde Hoffmann 1940 zum Dienst in der Wehrmacht eingezogen, um dann im selben Jahr, mit Unterstützung von Otto Franke, als Assistent an das Deutschland-Institut in Beijing entsandt zu werden. 1943 bis 1945 ging Hoffmann an die Deutsche Botschaft im Nanjing der Wang-Jingwei-Regierung (汪精衛), wo er außerdem Kurse an der Universität gab. Nach dem Zusammenbruch des Regimes kehrte er nach Beijing zurück, von wo aus er dann im Folgejahr zwangsweise repatriiert wurde und nach Deutschland zurückkehrte.
Nach 1947 beendete er seine Dissertation über Die Lieddichtung des Li Yü (937–978) und promovierte 1949 in Hamburg bei Fritz Jäger; diese Schrift reichte er 1952 in erweiterter Form an der Philipps-Universität in Marburg ein, wo ihm im selben Jahr noch die venia legendi für das Fach Sinologie zuerkannt wurde. Dort arbeitete er dann für zwei Jahre als Lehrbeauftragter, bevor er eine Diätendozentur übernahm und 1957 schließlich zum außerplanmäßigen Professor ernannt wurde. 1961–1964 wirkte er dann als ordentlicher Professor an der Freien Universität Berlin und gleichzeitig als Direktor des dortigen Ostasiatischen Seminars. Zum Sommersemester 1964 verließ er Berlin, um an der Ruhr-Universität Bochum die Professur für Sprache und Literatur Chinas zu bekleiden. Das gerade neugegründete Institut setzte sich damals aus Hoffmann, einem Assistenten, einer Wissenschaftlichen Hilfskraft und jeweils einem Lektor für Chinesisch und einem für Japanisch (für den Auf- und Ausbau der Japanologie) zusammen. Bis zu seiner Emeritierung 1976 wirkte Alfred Hoffmann maßgeblich am Aufbau des Instituts und vor allem auch an der Ausstattung der Fachbibliothek mit, wo heute noch die von ihm angesammelten Quellschriften seinem umfangenden sinologischen Sachwissen Zeugnis tragen. Anlässlich seiner Emeritierung 1976 richteten seine Schüler Wolfgang Kubin, Peter Leimbigler und Hans Link zu Ehren Hoffmanns eine Festschrift aus.
Nicht nur die Sektion für Sprache und Literatur Chinas, sondern auch die Sinologie hat Alfred Hoffmann, der 1997 in Bochum verstarb, zahlreiche Errungenschaften zu verdanken: Vor allem in jungen Jahren hatte sich Hoffmann auf das moderne China konzentriert und dabei besonders und als einer der ersten mit seiner Übersetzung einschlägiger Schriften Hu Shis 胡適 (1891–1962) auf die Bedeutung der literarischen Revolution in China aufmerksam gemacht. Hierzu trug er auch durch seine Erstübersetzungen umgangssprachlicher Erzählungen von Autoren wie Bingxin 冰心 (1900–1999), Zhu Ziqing 朱自清 (1898–1948) und Lu Xun 魯迅 (1881–1936) bei. Ebenso bedeutsam war die Vorstellung der Literaturgeschichte der späten Qing-Zeit von A Ying 阿英 (1900–1977), die er 1939 übersetzte. Später wandte sich Hoffmann dem alten China zu, wobei er unter anderem mit seiner Monographie Die Lieder des Li Yü (937–978) (Köln: Greven, 1950) einen wichtigen Beitrag zur Übersetzung und Interpretation der ci-Dichtung leistete. Ein weiteres Interesse Hoffmanns galt der Ornithologie: Auf diesem Gebiet ist ihm das 1975 herausgebrachte Glossar der heute gültigen chinesischen Vogelnamen (Wiesbaden: Harrassowitz, 1975) zu verdanken. Abgesehen von Hoffmanns sinologischen Leistungen jedoch bezeichnete Kubin ihn vor allem als „herausragenden Lehrer“, der seine Studierenden mit seinem großen Fundus an Wissen für China zu begeistern vermochte und gleichzeitig hohe Ansprüche an sie und sich selbst stellte: „Sie wurden von ihm ständig angetrieben und waren binnen kürzester Zeit mit ihrem Studium fertig.“
Die Lieddichtung des Li Yü (937–978) [1950]
Frühlingsblüten und Herbstmond [1951]
Glossar der heute gültigen chinesischen Vogelnamen [1975]
Neue chinesische Vogelnamen [1978]
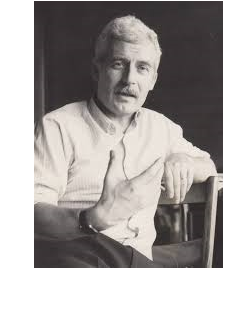
Helmut Martin war von 1979 bis 1999 als zweiter Lehrstuhlinhaber nach Alfred Hoffmann (1911–1997) an der Sektion für Sprache und Literatur Chinas an der Ruhr-Universität Bochum tätig. Seinem wissenschaftshistorischen Interesse und Wirken sind die Öffnung des Faches für das moderne China und Taiwan zu verdanken. Ferner steht Martin für die Mitbegründung des Sinicums am nordrhein-westfälischen Landesspracheninstitut (1980) und des Richard-Wilhelm-Übersetzungszentrums an der Ruhr-Universität Bochum (1993).
Martin wurde am 5. März 1940 in Kassel geboren. Nach seinem Abitur im Jahr 1959 studierte er Sinologie und Slawistik in München, Belgrad, Paris und Heidelberg. 1966 wurde er mit der Herausgabe seiner Heidelberger Dissertation Li Liweng über das Theater (später veröffentlicht als Li Liweng lun xiju 李立翁論戲劇, Taibei: Mei Ya Publications, 1968) promoviert, wurde 1966 Assistent am Sinologischen Seminar in Heidelberg und ging mittels eines Stipendiums für weitere Forschungsarbeiten zu Li Yu für drei Jahre nach Taiwan. Dort lernte der Sinologe seine Frau Tienchi Martin-Liao (廖天琪) kennen, mit der er in den frühen 1970er Jahren nach Deutschland zurückkehrte. 1972 bis 1979 wirkte Helmut Martin als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Asienkunde mit Zuständigkeit für die Innenpolitik der Volksrepublik China. In diesem Zeitraum betreute er zahlreiche wissenschaftliche Projekte, darunter die Herausgabe des Magazins China aktuell (1972), des Langenscheidt-Wörterbuchs Chinesisch-deutscher Wortschatz (1977) sowie die Übersetzung und Veröffentlichung sämtlicher Schriften Mao Zedongs in sechs Bänden (1979–1982). 1979 wurde er in der Nachfolge von Alfred Hoffmann (1911–1997) auf den Lehrstuhl für Sprache und Literatur Chinas berufen. Neben Tätigkeiten als Gastprofessor in Ostasien und den USA war Helmut Martin langjähriger Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Chinastudien (DVCS).
Helmut Martin setzte sich nicht nur für die Erforschung der in Taiwan lange tabuisierten nativen Literatur und die Arbeit der DDR-Sinologie ein, sondern pflegte auch Kontakte zu chinesischen Schriftstellern und Intellektuellen, die wegen ihrer oppositionellen Meinung in gesellschaftlicher Bedrängnis lebten. Gegenüber der chinesischen Regierung hegte er ein wissenschaftlich-kritisches Verhältnis, welches er anhand von Publikationen, Vorträgen oder Demonstrationen offen kundgab. Martins öffentlich-politisches Anliegen und seine Leidenschaft zur Wissenschaftshistorie machten ihn zusammen mit seiner Frau Tienchi Martin-Liao in den Reihen der deutschen Sinologie zum wohl wichtigsten Förderer der chinesischen Demokratiebewegung auf dem Festland sowie auf Taiwan. Helmut Martin muss ein bedeutender Anteil an der Förderung und Erforschung der modernen chinesischen Literatur angerechnet werden. Seine Publikationen zählen zu den wichtigsten deutschsprachigen Quellen zur politisch-intellektuellen Kultur der chinesischen Gegenwart und haben innerhalb der westdeutschen Sinologie das Interesse an der Erforschung des modernen China gesteigert. Auch das von ihm gegründete Richard-Wilhelm-Übersetzungszentrum, welches die sprach- und literaturwissenschaftliche Forschung an der Ruhr-Universität ergänzt, stellt einen maßgeblichen Schritt zur Öffnung des Faches für das moderne China dar.
Helmut Martin starb am 8. Juni 1999 im Alter von 59 Jahren. Sein Wirken in Forschung und sein politisches Engagement lassen sich an den zahlreichen Nachrufen messen, die ihm nach seinem Tode gewidmet wurden.

Raoul David Findeisen wurde 1958 in Saignelégier in der Schweiz geboren und studierte Sinologie, Japanologie, Romanistik, Vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie in Berlin, Taipeh, Beijing und Bonn. 1988–1989 war er zunächst als Übersetzer in Beijing tätig und in den Jahren 1990–1992 in der pharmazeutischen Industrie in Basel. Von 1993 bis 1999 wirkte Findeisen als Oberassistent an der Universität Zürich und arbeitete parallel dazu als Gymnasiallehrer für Chinesisch. Verschiedene Forschungsaufenthalte führten ihn nach Lyon, Bratislava, Shanghai und Beijing. Über die Zeit hinweg übte er Lehrtätigkeiten an den Universitäten Berlin (FU), Basel, Warschau, Genf, Jerusalem und Prag aus. An den Bochumer Lehrstuhl für Sprache und Literatur Chinas wurde er zum Wintersemester 1999/2000 zuerst als Vertretung berufen und 2001 schließlich zum Professor ernannt. Von 2004 bis 2008 war er außerdem Dekan der Fakultät für Ostasienwissenschaften. 2009 verließ er Bochum, um an der Comenius-Universität in Bratislava als Professor für Moderne chinesische Literatur zu arbeiten. Gleichzeitig gab er zahlreiche Gastvorträge am Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien. Zudem wirkte er als Gastprofessor an der Universität von Sichuan in Chengdu. Findeisen war Mitglied in den Vorständen der European Association of Chinese Studies (1996–2002) und der Deutschen Vereinigung für China-Studien (1999–2005). In den letzten Jahren seines Lebens widmete er sich vor allem der Förderung der Sinologie in der Slowakei und arbeitete als Herausgeber der Zeitschrift Studia Orientalia Slovaca, bevor er 2017 verstarb.
Findeisen galt als Experte zu Lu Xun 魯迅 (1881–1936), über den er promovierte und den Band Lu Xun. Texte, Chronik, Bilder, Dokumente (Frankfurt am Main: Stroemfeld, 2001) herausbrachte. Seine Forschungsinteressen galten vor allem der chinesischen Literatur der Republikzeit und, damit verbunden, der Literatursoziologie, der Komparatistik und der Übersetzungstheorie und -geschichte. Im Bereich der Textologie befasste er sich mit der Analyse von Manuskripten aus der Republikzeit, wobei er sich mit Hinsicht auf das letztere Forschungsfeld für einen besseren Austausch zwischen der chinesischen und westlichen Manuskriptforschung aussprach. Sein chinesischer Kollege Wang He 王賀 bezeichnete ihn als "Rückgrat der europäischen Sinologie" und "Mustergelehrten der modernen chinesischen Literaturwissenschaft" und sah seinen Tod als großen Verlust für die sinologische Forschung.
Henning Klöter übernahm zwischen 2009 und 2012 die Lehrstuhlvertretung der Sektion Sprache und Literatur Chinas. Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf die Sozio-, Missionars- und Koloniallinguistik. Zudem beschäftigt sich Klöter aktiv mit Taiwan- und sinophoner Literatur.
Henning Klöter absolvierte sein Studium der Sinologie, Germanistik und Politikwissenschaften an den Universitäten Trier und Leiden sowie an der National Taiwan University und der Capital Normal University in Peking. Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Übersetzer und Redakteur in Taipei (1997–1999) wurde er im Jahr 2003 mit einer Dissertation zum Thema Written Taiwanese (Wiesbaden: Harrassowitz, 2005) promoviert. Zwischen 2003 und 2005 arbeitete Klöter als Lektor und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum. Danach war er als Postdoktorand an der Universität Leiden (2005–2007) und Assistant Professor an der National Taiwan Normal University (2007–2009) tätig. Während seiner Lehrstuhlvertretung an der Ruhr-Universität Bochum habilitierte sich Henning Klöter im Jahr 2010 zum Thema The Language of the Sangleys: A Chinese Vernacular in Missionary Sources of the 17th Century (Leiden: Brill, 2011). Im Anschluss daran lehrte Klöter als Professor für Chinesisch (Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaften) und chinesische Fachdidaktik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz (2012–2013) und anschließend an der Georg-August-Universität in Göttingen (2013–2015). Seit 2015 forscht und lehrt er am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin und fungiert seit Oktober 2018 als Direktor desselben Instituts. Henning Klöter war zudem Herausgeber der Studia Formosiana (2003–2015) der Taiwan Research Unit und betreut seit 2013 die Reihe Sinolinguistica (herausgegeben seit 1991).
Rüdiger Breuer vertrat zwischen 2012 und 2016 den Lehrstuhl für Sprache und Literatur Chinas an der Ruhr-Universität Bochum. In der Forschung befasst er sich mit umgangssprachlicher Erzählliteratur von der Song- bis zur Qing-Zeit, dem Zusammenhang von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der chinesischen Literatur, aufführenden Literaturgattungen wie dem Theater sowie in jüngerer Zeit auch zum Werk der chinesischen Gegenwartsautoren Mo Yan 莫言, Yu Hua 余华 und Yan Lianke 阎连科.
Rüdiger Breuer erlangte 1995 das Magistrat in den Studienfächern Sprache und Literatur Chinas, Sprache und Literatur Japans und Volkswirtschaftslehre in Bochum und Taipei. Nach einem sechsjährigen Promotionsstudium der Chinesischen und vergleichenden Literaturwissenschaften an der Washington University in Saint Louis, USA, (1995–2001) wurde er mit einer Dissertation zum Thema Early Chinese Vernacular Literature and the Oral-Literary Continuum promoviert. In diesem Zeitraum unterrichtete er an der Washington University und der University of Missouri in Saint Louis. Rüdiger Breuer wirkt seit April 2002 zunächst als Lektor für Chinesisch, seit Oktober 2002 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität und wurde im Jahr 2011 zum Studiendekan der Fakultät für Ostasienwissenschaften ernannt. Er war Mitglied in den Vorständen der European Association of Chinese Studies (2012–2016) und der Deutschen Vereinigung für China-Studien (2005–2011, 2013–2019). Überdies ist er Redaktionsleiter des Bochumer Jahrbuchs für Ostasienforschung (BJOAF), welches seit 1978 in ununterbrochener Reihenfolge von der Fakultät herausgegeben wird.